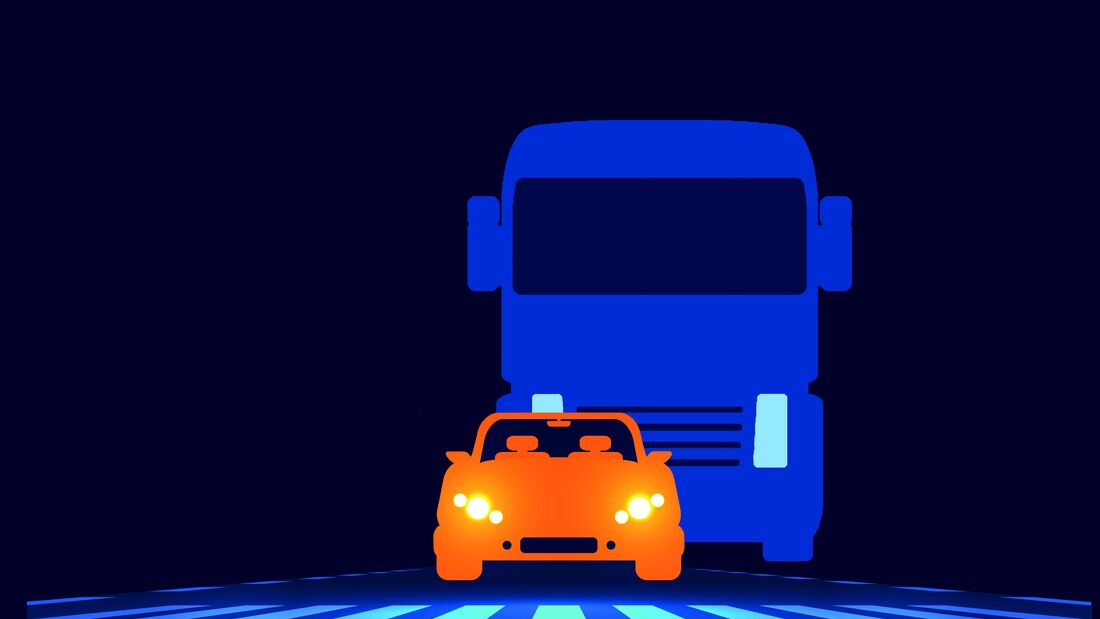Prof. Iskan: Ganz klar ist das die Halbleiterkrise, die die europäische Automobilproduktion weiter ausbremst. Die Nachfrage ist da, aber aufgrund der fehlenden Zwischenprodukte wie Halbleiter ist der Output der Hersteller nicht ausreichend. Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist die Situation ähnlich – das Angebot ist gering und dazu noch hochpreisig.
Die OEMs spielen gegenüber ihren Partnern in den Lieferketten nicht mit offenen Karten. Ich bin maximal überrascht, wie viele Logistiker noch von kurzfristigen Zeiträumen ausgehen, in denen es die Störungen gibt. Die Halbleiterkrise, die ja auch den Maschinenbau und die Elektro- und IT-Industrie betrifft, dauert weiter an, die langen Lieferzeiten werden sich meiner Meinung nach mindestens bis zum vierten Quartal 2022 hinziehen. Erste Entspannungen bei den Halbleitern sind frühestens zum ersten oder zweiten Quartal 2023 zu erwarten. Das sagen die OEMs aber nicht. Es mangelt übrigens nicht nur an Halbleitern; auf dem Rohstoffmarkt wird auch Magnesium knapp, das etwa für die Stahlproduktion der Karosserien gebraucht wird.
Wenn man naiv ist und sich nicht darauf einstellt, dass die Krise mindestens noch ein Jahr dauert. Natürlich geht es in erster Linie um die Existenz der OEMs, die daher nicht umsonst jede Kompensation wegdrücken. Und dann geht es – in einer partnerschaftlichen Supply Chain – auch um die Lieferanten und Logistiker. In der Summe leidet die ganze automobile Lieferkette, auch die Logistiker für die Fertigfahrzeuge sind natürlich betroffen.
- Zugang zu allen Webseiteninhalten
- Kostenloser PDF-Download der Ausgaben
- Preisvorteil für Schulungen und im Shop
Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen.
* Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer.
Mitgliedsnummer ergänzen* Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar.
Weiter zum Kauf Halbleiterkrise trifft auch die Automobillogistik
Halbleiterkrise trifft auch die Automobillogistik