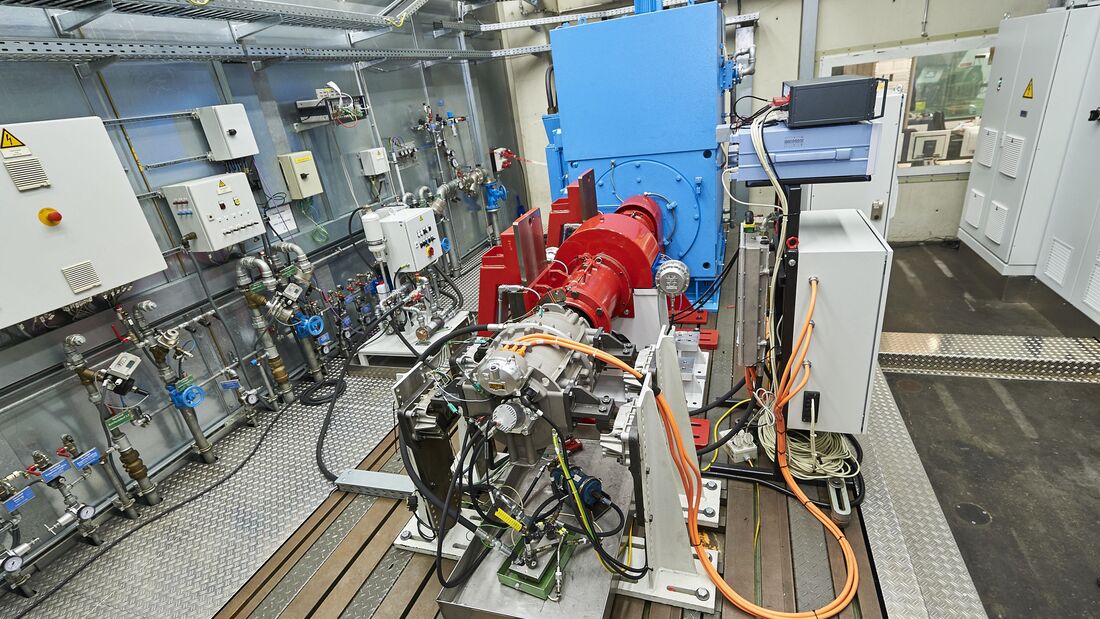Witzig: Die Entwicklungsziele für CeTrax lassen sich zu den Schwerpunktthemen höchster Wirkungsgrad, ausreichende Performance auch für anspruchsvolle Anwendungen – sowohl aus dem Bus- wie auch aus dem Verteiler-LKW-Bereich – mindestens gleiche Zuverlässigkeit und Lebensdauer wie konventionelle Antriebe, Kostensensitivität sowie kurze Entwicklungszeit zusammenfassen. Daraus ergeben sich verschiedene Randbedingungen für die Entwicklung. Wir haben beispielsweise mit dem Asynchronmotor (ASM) in der Entwicklung angefangen, weil wir das Konzept aus dem Nutzfahrzeugbereich und den laufenden Hybridaktivitäten bereits gut kennen und es unserer Meinung nach auch viele Vorteile bietet. Dazu gehören Robustheit und geringere Kosten ebenso wie der hohe Wirkungsgrad insbesondere bei hohen Drehzahlen. Außerdem lässt sich der ASM-Motor ohne so genannte seltene Erden produzieren, was einkaufsseitig eine Herausforderung sein kann. Wie gesagt ist eines der Entwicklungsziele bei CeTrax also, den hohen Wirkungsgrad der ASM im Hochdrehzahlbereich auch auf den Bereich mittlerer Motordrehzahlen zu erweitern, da dieser insbesondere im Stadtverkehr relevant ist und eins zu eins auf die Fahrzeugreichweite einzahlt. Wir haben es in mehreren Entwicklungsschleifen geschafft, das Optimum des Wirkungsgrades in den Bereich von 3.000 bis 4.000 Umdrehungen zu verlagern, das entspricht in etwa einer Fahrzeuggeschwindigkeit von 40 bis 50 km/h. Mit dem sehr ambitionierten Zeitplan für die Entwicklung haben wir uns natürlich zuerst auf das Konzept konzentriert, mit dem wir bereits am meisten Erfahrungen hatten. Nur so können wir mit einer zuverlässigen Lösung schnell am Markt sein, wo ein kurzfristiger Bedarf für ein wirkungsgradoptimiertes Konzept besteht. Wir gehören im Markt vielleicht nicht zu den ersten, die ein solches Konzept bieten, aber wir bieten einige wesentliche Punkte, die andere so nicht anbieten können, da wir den gesamten Antriebsstrang bei der Systemoptimierung betrachten können und nicht auf bestehende Lösungen, die vielleicht nicht optimal passen, zurückgreifen müssen. Beim Projektstart im Oktober 2016 hatten wir uns zum Ziel gesetzt, im dritten oder vierten Quartal 2018 zumindest mit einer volumenbeschränkten Vorserie ins Feld zu gehen – große Stückzahlen können dann ab 2019 geliefert werden. Ziel ist also, die genannten Vorteile der ASM-Technologie auf die Bedürfnisse im städtischen Nutzfahrzeugverkehr hin zu erweitern und die technologisch größeren Herausforderungen einer PSM-Maschine, wie beispielsweise höhere Sicherheitsanforderungen beim Fahrzeugabschleppen sowie der Gefahr einer Demagnetisierung durch Überhitzung außen vor zu lassen.
Witzig: Der Wirkungsgrad-Unterschied zwischen beiden Konzepten im relevanten Fahrbereich liegt bei unserem Konzept nur noch bei rund einem Prozent, da haben die Kollegen im ASM-Projekt einen guten Job gemacht. Allerdings ist der jeweilige Wirkungsgrad stark abhängig von den dominierenden Betriebsbedingungen, so dass es auch Anwendungsfälle mit teilweise sehr geringen Durchschnittsgeschwindigkeiten wie es z.B. in London der Fall ist, bei der die PSM-Technologie nach wie vor Vorteile hat. Außerdem gibt es Marktregionen, die die Verwendung von seltenen Erden präferieren. Genau deswegen entwickeln wir beide Konzepte. Oder um einen Vergleich zu ziehen: Es handelt sich um einen analogen Unterschied wie beim Gas- und Dieselmotor im Bus. Beide haben ihre Vorteile und ihre Berechtigung und beides wird es noch eine ganze Weile geben. Wir möchten daher in der Lage sein, beide Konzepte anbieten zu können, und das im gleichen Gehäuse. Damit bieten wir den Kunden die Möglichkeit einer Plattformstrategie bei einer gleichzeitig optimal auf den Einsatzfall abgestimmten technischen Lösung.
Witzig: Sie werden den Unterschied von außen nicht sehen können, auch die Fahrleistung und -performance wird sich nicht grundlegend unterscheiden. Für den Kunden stellen wir immer den für den jeweiligen Anwendungsfall wirkungsgradoptimalen Antriebsstrang zur Verfügung. Das führt bei der Designvariante für den ASM zu etwas mehr Aufwand, aber wir bekommen daraus mehr Variabilität und können im Markt flexibler agieren. Wir bieten dem Kunden beispielsweise an, seine jeweiligen Strecken exakt zu vermessen, um die Eignung der beiden Konzepte im Sinne einer Antriebsstrangberatung für diese Strecken zu verifizieren und auch eine fundierte Empfehlung für eine Variante aussprechen zu können. Dabei nutzen wir selbstverständlich auch Know How, das wir mit unseren konventionellen Getrieben gewonnen haben. Für Städte wie London dürfte dann auf den meisten Strecken sicher der PSM-Motor Vorteile bieten, für Städte mit schnelleren Routen wie Mannheim dürfte dagegen das ASM-Aggregat ihre Vorteile ausspielen. Auf der Kostenseite wird die ASM etwas preisgünstiger anzubieten sein, da man ja auf die seltenen Erden verzichten kann. Die PSM wird rund ein Jahr später Serienstart haben, da wir hier beispielsweise noch an der Entwicklung eines gesamthaften Sicherheitskonzepts arbeiten.
- Zugang zu allen Webseiteninhalten
- Kostenloser PDF-Download der Ausgaben
- Preisvorteil für Schulungen und im Shop
Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen.
* Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer.
Mitgliedsnummer ergänzen* Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar.
Weiter zum Kauf Interview mit Dr. Jochen Witzig von ZF
Interview mit Dr. Jochen Witzig von ZF