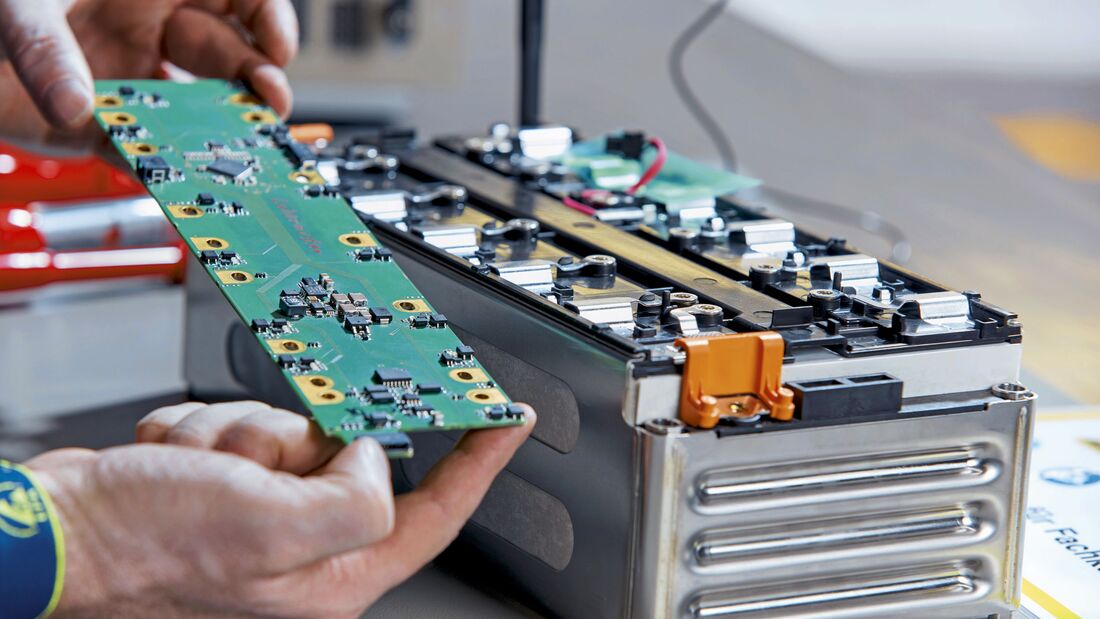Weltweit wird derzeit intensiv an evolutionären Verbesserungen sowie neuen Technologien auf Zellebene mit noch weiter erhöhter Energie sowie an Lösungen für Brennstoffzellentechnologien gearbeitet. Bei den neuen Ansätzen sind die Feststoffbatteriezellen der vielversprechendste Ansatz, allerdings ist hier nicht klar vorhersagbar, wann der Durchbruch in der Entwicklung und Industrialisierung erfolgt, denn die neue Technologie muss ja kostengünstig produziert werden können. In diesem Zusammenhang sollte zudem als einer der ersten Schritte der Bau entsprechender Fabriken im großen Maßstab erfolgen. Insofern sehen auch wir, dass frühestens 2025 mit kommerziell verfügbaren sprunghaften Innovationen in diesem Batteriesektor zu rechnen ist. Und ist die Solid-State-Technik erst einmal marktreif, müssen vermutlich komplett neue Fertigungsverfahren etabliert werden. Bis dahin wird aber auch die konventionelle Li-Ionen-Batterietechnologie weiterentwickelt werden, sodass die Vorteile der Festkörperbatterie zu Beginn überschaubar sein dürften. Li-Ionen-Batterien werden daher noch sehr lange eine harte Konkurrenz für Festkörperbatterien sein – und sind ihnen allein durch die bereits getätigten Investitionen in eine etablierte Lieferstruktur und den Ausbau der Giga-Factorys einen Schritt voraus. Im Vergleich zu den heute in Produktion befindlichen Nutzfahrzeugbatterien werden wir in den kommenden Jahren die Energiemenge bei fast gleichem Gewicht und gleicher Größe schrittweise verdoppeln. So können beispielsweise mit dem ab 2021 für einen Großkunden in Serie gehenden AKASystem CYC, unserer dritten Batteriesystemgeneration, vollelektrische Stadt- sowie Reisebusse je nach Fahrzeuggröße mit Batteriesystemkapazitäten zwischen 600 und 1.000 Kilowattstunden (kWh) ausgestattet werden.
Für Akasol ist entscheidend, dass sich auch mit heutiger Technik bereits viele Anwendungen sinnvoll mit elektrischen Antrieben betreiben lassen, die bis vor Kurzem noch dem Verbrennungsmotor vorenthalten waren. Als Systemlieferant beschäftigen wir uns mit den meisten wesentlichen Zellchemiealternativen, um hier bei technologischen Durchbrüchen rechtzeitig auch mit neuen applikationsgerechten Batteriesystemen am Markt präsent zu sein. Li-Schwefel- oder Li-Luft-Zellen stehen jedoch noch vor erheblichen technischen Herausforderungen, die in der Grundlagenforschung erst noch gelöst werden müssen – zum Beispiel im Hinblick auf die Lebensdauer.
Wenn man sich die Geschichte der Lithium-Ionen-Batterien anschaut, dann sind die ersten kommerziellen Zellen Anfang der 90er entstanden. Bis heute hat man fast 30 Jahre für die Industrialisierung gebraucht und die Technologie ist auch noch nicht am Ende. Wir erwarten für die Zukunft alle drei bis vier Jahre Effizienzsprünge im zweistelligen Prozentbereich, wovon alle elektrischen Mobilitätsanwendungen profitieren werden. Wenn Sie aber von den radikal neuen Batterietechnologien reden, dann glaube ich, dass es eher Jahrzehnte als Jahre dauern wird, bis wir diese in der Serienproduktion sehen. Das sind bisher überwiegend reine Laboranwendungen.
- Zugang zu allen Webseiteninhalten
- Kostenloser PDF-Download der Ausgaben
- Preisvorteil für Schulungen und im Shop
Sie haben bereits ein Digitalabo? Hier einloggen.
* Sie sind DEKRA-Mitglied? Dann loggen Sie sich ein und ergänzen ggf. in Ihrem Profil Ihre DEKRA-Mitglieds-Nummer.
Mitgliedsnummer ergänzen* Jahrespreis 22,65 Euro, Preis für FERNFAHRER Flexabo Digital in Deutschland,flexible Laufzeit, jederzeit kündbar.
Weiter zum Kauf Batterietechnologie
Batterietechnologie